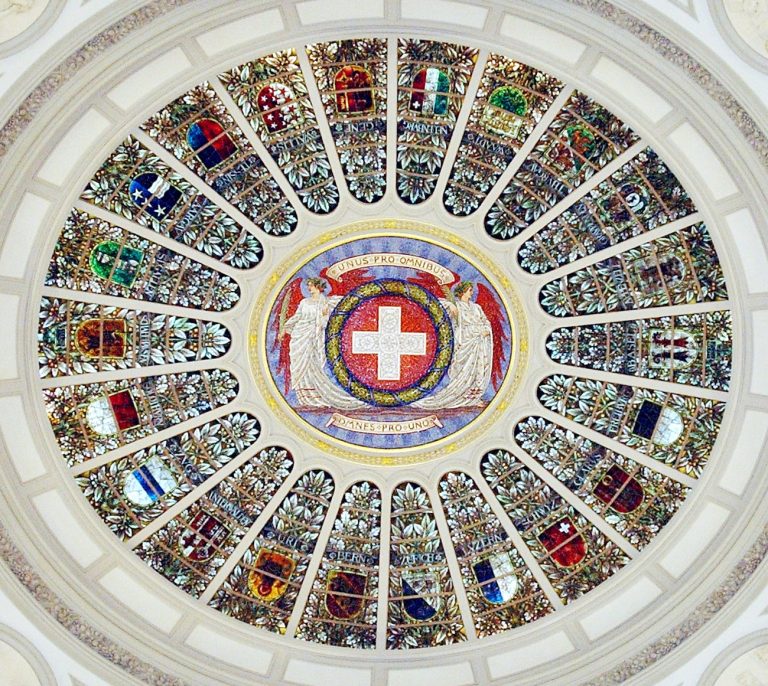
Freitag, der 20. Dezember 2024, bietet Stoff für ein ganzes Mani-Matter-Album. Absurde Anekdoten, C-Dur, a-Moll, «metaphysisches Gruseln» in drei Akten. Am Vormittag laden die Mitglieder der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zum Gedenkgottesdienst der Crédit Suisse, oben, unter dem Giebel des Bundeshauses. Haben die Behörden beim Niedergang der einst so stolzen Grossbank gesündigt?
SP-Nationalrat Roger Nordmann warnt davor, die Kritik allein auf die Finanzmarktaufsicht (Finma) zu konzentrieren. Bei Ueli Maurer, dem damaligen Finanzminister, stört ihn die Einseitigkeit weniger – im Gegenteil. Der SVP-Bundesrat wird offiziell zum Abschuss freigegeben, unter anderem weil er damals, im Herbst 2022, seine Bundesratskollegen zu spärlich über den kritischen Zustand der CS informiert habe.
Was am Freitag zwar erwähnt, aber kaum gewürdigt wird: Zu jener Zeit befand sich der Bundesrat als Kollegialbehörde in einer verheerenden Vertrauenskrise. Nach zwei Jahren Corona-Politik und den systematischen Indiskretionen, unter anderem durch das Umfeld von Gesundheitsminister Alain Berset, traut Maurer seinen Amtskollegen nicht mehr über den Weg. Er hat Angst, dass Medienberichte den Untergang der Bank unaufhaltbar beschleunigen könnten. Heute weiss man: Es war schon damals zu spät.
Maurer will die CS retten, wie er während der ersten Viruswelle die Covid-Kredite organisiert hatte: auf seine Art, unkompliziert, unbürokratisch. Dieser genossenschaftliche Ansatz funktioniert indes nicht bei der Schweizer Grossbank, deren Firmenkultur längst korrumpiert, ja tot war. Ueli Maurer, und diese Erkenntnis schmerzt besonders, ist es nicht mehr gelungen, der CS ihre weltläufige Swissness wieder einzuhauchen. Ende 2022 verliess der Zürcher den Bundesrat.
Der PUK-Bericht ist auch die Rache der politisch-medialen Classe politique, eine Retourkutsche und Disziplinierungsmassnahme des Establishments. Es verachtet Menschen wie Maurer, die der Schweiz und ihrer Bevölkerung nach wie vor helvetische Langzeitkonzepte wie Eigenverantwortung, Subsidiarität oder Selbstachtung zumuten. Maurer führte in seinem Departement eine schlanke Personalpolitik, sagte immer, was er dachte, nicht, was andere hören wollte. Der Antipode von Viola Amherd, niemand verkörpert dieses Establishment, das bundesbern’sche Juste Milieu besser als die Mitte-Bundesrätin.
Die Bundespräsidentin steht im Mittelpunkt des zweiten Akts an diesem denkwürdigen Freitag. Am Nachmittag lud sie die Journalisten in den Bernerhof, früher ein Hotelbetrieb, seit genau 100 Jahren im Besitz der Eidgenossenschaft. Hier herzte sie Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, wie eine alte Klassenkollegin. Beide gaben ein Statement ab, von der Leyen sprach ständig von «wir». Meinte sie damit die Schweiz oder die EU? Oder bereits beides zusammen in einem? Man weiss es nicht. Fragen liessen die Frauen keine zu. Eine Brise Brüssel im Bernerhof.
Für von der Leyen ist Amherd als EU-Statthalterin in Bern ein Glücksfall. Die Walliserin hat die Schweiz längst aufgegeben. So war Amherd für eine Ausgangssperre während Corona. Sie wollte die Medien- und Meinungsfreiheit einschränken, indem sie – analog zur EU – russische Staatssender sperren wollte. Als der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall mit der Anfrage anklopfte, fast 100 Kampfpanzer des Typs Leo 1 zu kaufen und an die Ukraine weiterleiten zu dürfen, liess sie die Sache laufen – Neutralität hin oder her.
Erst vor kurzem machte die Weltwoche publik, dass Amherd im kommenden Frühjahr mit der Nato den sogenannten Bündnisfall üben will. Zudem wollte sie die Schuldenbremse lockern, das Kollegialitätsprinzip ritzte sie mehrfach. Zuletzt sagte sie im Plenum des Nationalrats unverblümt die Unwahrheit. Ueli Maurer hätte man für äquivalente Verstösse medial geröstet. Bei Amherd ist man nachsichtig. Dass sie primordiale Werte des Schweizer Staatswesens verhökert, nehmen ihr die Journalisten nicht übel. Viele sehen es gleich. Einer Umfrage zufolge verorten sich dreiviertel davon im linken Spektrum.
Der Ausverkauf der Schweiz, billig veräusserte Souveränität – das sind schon längst keine Triggerpunkte mehr in der Bundeshauptstadt, alles muss weg. Vom Bernerhof ging es dann am Freitagnachmittag weiter ins Medienzentrum. Vorbei an «Mass-voll!»-Demonstranten und viel Polizei. Hier erklärten die Bundesräte Ignazio Cassis, Guy Parmelin und Beat Jans vor einer Reihe Spitzenbeamten und einem Saal voller Journalisten, warum die ausgehandelten Verträge mit der EU so gut sein sollen für die Schweiz.
Weil dies während der Pressekonferenz hör-, aber nicht wirklich spürbar wurde und weil Fragen jetzt genehm waren, wollte es Larissa Rhyn, Bundeshauschefin bei den Tamedia-Zeitungen, genauer wissen. Im Sinn eines Vorstellungs- oder Verkaufsgesprächs sollten alle drei Magistraten kurz ihre Begeisterung für den EU-Deal an den Tag legen. Für Cassis sind die Verträge «notwendig», Parmelin sprach von erreichter Zielsetzung. Bei Jans war man im Saal erleichtert, dass er die Frage verstanden hatte.
Auf die Spezifitäten und konkreten Bedingungen für die verhandelte Schutzklausel angesprochen, hielt sich der Justizminister zuvor zurück. Ob jetzt ein völlig ausgetrockneter Mietwohnungsmarkt mit ein Grund sein könnte, Massnahmen gegen die Zuwanderung zu ergreifen – «auf dieser Flughöhe» habe man nicht verhandelt, sagte Jans.
Man kann nur hoffen, dass die Bundesräte wissen, was sie tun, hoffen, dass sie umfassend orientiert wurden, bevor sie den Ausverkauf der Schweiz der Öffentlichkeit präsentiert haben. Haben sie den Wortlaut des Vertragswerks überhaupt schon gesehen? Braucht es irgendwann eine PUK über diesen schwarzen Freitag und die Folgejahre?
Es war ein klassischer Bankrun, d.h. das Vertrauen in die CS hat gefehlt. Keine Bank kann das überleben. Der Bundesrat mit KKS hätte hin stehen sollen und auf allen Kanälen sagen müssen, dass sie die CS retten werden, egal was es kostet, nur so wäre ein Bankrun zu verhindern gewesen. Angefangen hat es damit, dass die Schweiz russische Konten gesperrt hat, wonach alle anderen in Panik geraten sind.
Vielleicht hilft jetzt nur noch eine oder am besten zwei weitere schweizer Rechtsparteien (a la AfD - eine Af-Suisse?) mit jeweils ganz eigenem Profil, die dann in der Zukunft, im Verbubd mit der SVP eine absolute Mehrheit erlangen könnten? Just an idea.
In allen Regierungen gibt es Kräfte (->Cabal), die im geheimen daran mitwirken, die „alte Ordnung“ von innen heraus zu zerstören, um letzlich eine „New World Order“ zu etablieren (->Georgia Guidestones). Das Ziel besteht darin, eine „Agenda 2030“ unzusetzen, die moralisch über „Save the Planet“ legitimiert wird, jedoch in Wahrheit darauf abzielt, ein „Social Credit System“ mit Totalüberwachung nach dem Vorbild Chinas zu errichten.