

Bild: Everett Collection / Everett Col
4 Kommentare zu “Knef, die Grosse”
Schreiben Sie einen Kommentar
Sie müssen sich anmelden, um einen Kommentar abzugeben.
Noch kein Kommentar-Konto? Hier kostenlos registrieren.
Bitte beachten Sie die Netiquette-Regeln beim Schreiben von Kommentaren.
Den Prozess der Weltwoche-Kommentarprüfung machen wir in dieser Erklärung transparent.







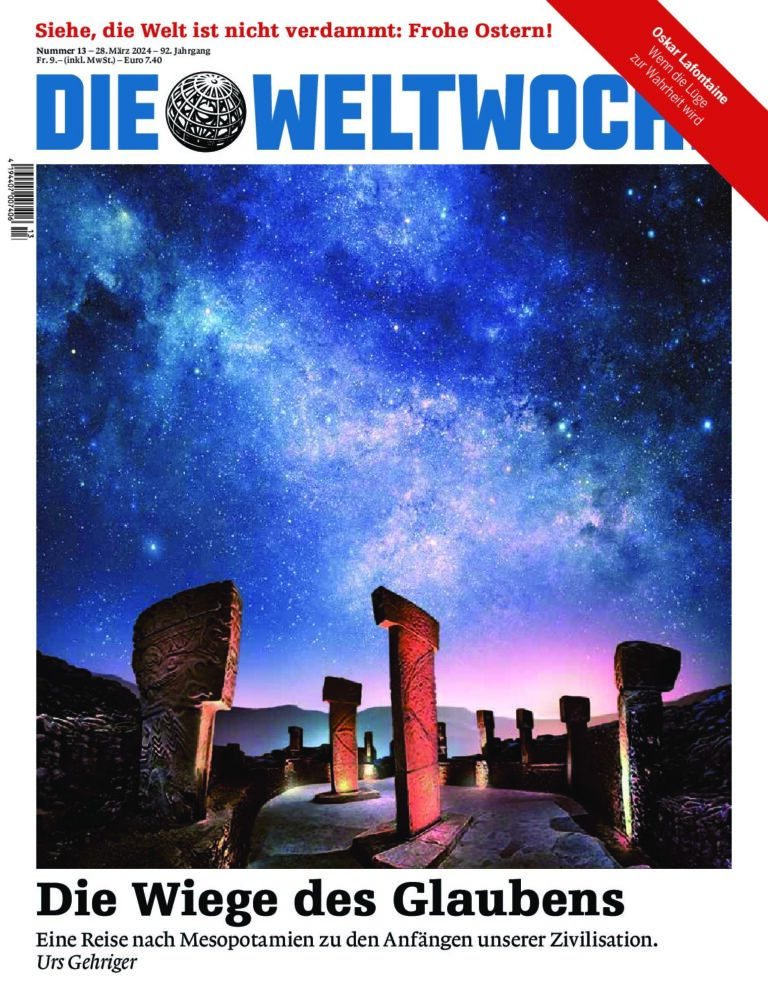

 Michael Maar
Michael Maar
Von nun an ging's bergab: Von Hildegard Knef (übrigens geborene Schwäbin) bis zu der unsäglichen Helene Fischer.
Einfach eintoller Artikel. Vielen Dank!
Die Knef avancierte zum Idol des Volkes, gerade wegen ihrer legendären Aussagen „ne Dame werd‘ ich nie“ und (im Heute gut passend) „von nun an geht’s bergab“
Hildegard Knef's "rote Rosen" wurde in meinem Elternhaus (ich bin 1960 geboren) oft gehört, wir sahen sie im Fernsehen..... für mich hatte sie immer eine Aura zwischen Erfolg und Verzweiflung, melancholischer Stimmung und Kraft, Mut, und Glück im Unglück...oder umgekehrt.....
Da steht dann wohl aus, ihre schriftstellerische Seite kennen zu lernen...... Danke für den Artikel