

INTERVIEW
Gebäude und Infrastruktur der Schweiz stehen wegen steigender Ansprüche und wachsender Bevölkerung unter enormem Anpassungsdruck. Was tun? Empa-Forscher Peter Richner erklärt, wie man künftig Häuser bauen muss und was er von Beton hält.
Die Schweiz hat heute über zwei Millionen mehr Einwohner als 1990, die Ansprüche an den Wohnraum sind gestiegen, auf den Strassen drängen sich mehr Autos denn je, die Bahn kommt an Kapazitätsgrenzen, die Energieversorgung ist zwischendurch zum Notfallthema geworden und Klimafragen drücken. Wie schafft man es, unter diesem Anpassungsdruck die Infrastruktur des Landes auszubauen und intakt zu halten? Welche privaten und öffentlichen Werte stehen auf dem Spiel? Wo liegen die Prioritäten, wenn man begrenzte Mittel möglichst effizient einsetzen will?
Wir fragen Peter Richner, Spezialist für nachhaltiges Bauen, nach seinen Einschätzungen. Der stellvertretende Direktor und Departementsleiter an der Empa in Dübendorf, der Forschungsanstalt für Materialwissenschaften und Technologie des ETH-Bereichs, betreut das Projekt «Entwicklung Bauwerk Schweiz» – eine Art Gesamtschau von Gebäuden, Strassen- und Schienenwegen, Energieanlagen, Ver- und Entsorgungsnetze, vom «Gebauten» in der Schweiz. Wir treffen Richner bei seinem Versuchsgebäude «Nest» an der Empa.
Weltwoche: Herr Richner, die Schweiz ist eine Insel der Stabilität. Gilt das auch für all das, was man im Land gebaut hat? Oder drohen jetzt Wertverluste wie in Deutschland, weil viele Häuser Energievorschriften nicht mehr erfüllen?
Peter Richner: Herausragendes Merkmal der Schweiz ist, dass wir ein sehr hochstehendes Bauwerk haben. Das wurde über Jahrhunderte in einer Art und Weise entwickelt, die unglaublich ist. Im Transportsektor bauten Pioniere wie Alfred Escher Eisenbahnlinien, in den 1950er und 1960er Jahren bauten wir das Nationalstrassennetz, jüngst erstellte man das grosse Bahnprojekt Neat. Und überdies bewältigten wir ein enormes Bevölkerungswachstum.
Weltwoche: Verdient die Qualität des Bauens ebenfalls Lob?
Richner: Nicht durchgehend. In den Boomjahren nach den 1950er bis in die 1980er Jahre hat man gesündigt, einfach auf Tempo gebaut. Klar, man war gezwungen, möglichst viel zu produzieren, aber der Qualitätsanspruch wurde vernachlässigt. Viele Gebäude aus dieser Zeit sind schwierig auf den Betrieb mit erneuerbaren Energien auszurichten. Die Gebäudehülle wurde nicht entsprechend isoliert, das kostet jetzt viel Geld, darunter leiden wir heute.
Weltwoche: Wie gross ist das Problem?
Richner: Es handelt sich heute um 1,2 bis 1,5 Millionen Gebäude, die zu sanieren sind. Man kennt das Problem schon lange, hat es aber vor sich hergeschoben, bis die Energieknappheit nun plötzlich Druck erzeugt. Auch aus Klimasicht ist Handeln dringlich.
Weltwoche: Heisst das Umstellen auf Wärmepumpen?
Richner: Wenn in einem schlecht isolierten Haus heute die Ölheizung aussteigt und Zeit oder Mittel fehlen, um Dach, Fenster und Fassade zu renovieren, dann haben Wärmepumpen einen sehr schlechten Wirkungsgrad. So gesehen, können die neuen Energievorschriften zu suboptimalen Lösungen führen. Aber wichtig ist bei Gebäuden ja nicht nur der Energieaspekt.
Weltwoche: Was auch noch?
Richner: Unsere Ansprüche als Gesellschaft an eine Wohnung, etwa bezüglich Grundriss oder Fensterflächen, sind im Wandel. Da sind gewisse Gebäude aus den sechziger und siebziger Jahren auch architektonisch veraltet. Das bedeutet insgesamt eine grosse Altlast, sehr viel Geld steckt da drin, viel Material und viel graue Energie sowie CO2-Belastung.
Weltwoche: Was soll man damit tun?
Richner: Die Energieargumente sprechen für rasches Renovieren, gesellschaftlich ist der Druck jedoch etwas geringer. Angesichts der Wohnraumknappheit lässt sich heute eigentlich praktisch alles vermieten.
Weltwoche: Wenn es so ist, muss man sich denn überhaupt um den Gebäudepark der Schweiz gross sorgen?
Richner: Ja, Bauten sind ein wichtiger Teil dessen, was unsere Lebensqualität ausmacht. Menschen sind wahrscheinlich zu 80 bis 90 Prozent ihrer Zeit in Gebäuden. Und wenn sie nicht drinnen sind, sind sie typischerweise unterwegs auf einer Transportinfrastruktur, die das eine Gebäude mit dem anderen verbindet. Zudem brauchen wir enorme Mengen an Material beim Bauen. Das Bauwerk Schweiz enthält insgesamt rund 400 Tonnen Material pro Kopf. Also Gebäude, Strassen- und Schienenwege, Energieanlagen, Ver- und Entsorgungsnetze, alles, was man verbaut hat. Und pro Jahr kommen vier bis fünf Tonnen pro Kopf dazu.
Weltwoche: Neuere Häuser sind aber in der Schweiz in Ordnung?
Richner: Ja, Neubauten sind fit. Aber auch viele wirklich alte Häuser. Eine Altstadtwohnung in Bern genügt höchsten Ansprüchen an Lebens- und Bauqualität.
Weltwoche: Viele Eigentümer der Problemhäuser sind ja wohl ältere Leute.
Richner: Ja, und das ergibt Probleme. Versuchen Sie mal, mit 75 Jahren einen Hypothekarkredit für gut 100 000 Franken zu erhalten, um Ihr Haus zu renovieren. Keine Chance. Da wäre eben mehr Kreativität gefragt.
Weltwoche: In welcher Richtung?
Richner: Vorstellbar wäre eine Renovationshypothek, die nicht an den Eigentümer, sondern an das Objekt gebunden ist, mit einem Horizont von beispielsweise dreissig Jahren. Sie würde im Grundbuch eingetragen, Geldgeber könnten sich auf diese Weise absichern. Es wäre eine Art Energieinvestition, die nicht von der Tragbarkeit des Eigentümers abhängt. Das wäre meiner Ansicht nach eine aussichtsreichere Art, Pensionskassengelder zu investieren, statt einfach in Niederbuchsiten ein neues Mehrfamilienhaus zu erstellen.
Weltwoche: Jetzt hatten wir im Gotthard gerade zwei grössere Probleme mit Tunnels und Blockaden. Ist die Verkehrsstruktur der Schweiz wacklig?
Richner: Nein, bei der Infrastruktur sind wir auf einem sehr hohen Niveau. Beim Gotthard-Eisenbahntunnel können die Güterzüge immerhin wieder durchfahren, daneben ist die alte Bahnlinie verfügbar. Und der Autotunnel ist nach dem Zwischenfall ebenfalls wieder befahrbar. Es gibt doch eine gewisse Redundanz im System, das ist eine echte Leistung. Aber Resilienz hat auch ihre Grenzen, vor allem von den Kosten her.
Weltwoche: Wo sollte man aber nicht zu sehr sparen?
Richner: Aufpassen müssen wir bei Betrieb und Unterhalt, das darf man nicht unterschätzen. Heikel ist auch alles, was unter dem Boden und unsichtbar ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden grossräumig Wasserversorgungs- und Entsorgungsanlagen eingerichtet, die man in Schuss halten muss.
Weltwoche: Wo sehen Sie die grössten Gefahren für das Bauwerk Schweiz?
Richner: Der schwierigste Bereich auf Bundesebene ist der Bau eines Hochspannungsnetzes. Das ist in der Schweiz ein Multi-Generationenprojekt. Das bringen wir einfach nicht zustande, wissen aber, dass wir in dieses Netz investieren müssen. Letztes Jahr ging mit Nant de Drance das grösste Pumpspeicherwerk in Betrieb, konnte aber nur voll genutzt werden, weil die Leitung über den Gemmipass per Notverordnung auf eine höhere Spannung gebracht wurde. Man denke, Notbetrieb. Die Weiterentwicklung unserer Infrastruktur kommt nicht voran.
Weltwoche: Was sind die Risiken?
Richner: Dass wir die erneuerbaren Energien, die wir ausbauen, irgendwann nicht nutzen können, weil das Netz nicht ausgebaut ist. Und ohne Stromabkommen mit der EU kommen wir mit unseren Netzen noch näher an den Anschlag, im schlimmsten Fall Netzzusammenbruch. Aber Energieprobleme gibt es auch bei kantonalen Strukturen.
Weltwoche: Wo?
Richner: Nehmen wir die Grimselwerke. 2002 haben wir von der Empa aus mit dem berühmten Brückenbauer Christian Menn ein Konzept für die neue Brücke erstellt für den Fall der Staumauererhöhung. 2021 gab es einen Gerichtsbeschluss, der einen Richtplan verlangt. Die Organisationen Greina Stiftung und Aquaviva wehren sich gegen die Aufstockung im neuen Gletschervorfeld. Dies verschiebe ja nur die Stromproduktion vom Sommer in den Winter. Ja – genau das braucht es ja gerade. Wir haben doch ein Winterstromproblem.
Weltwoche: Und die Probleme auf Stufe Gemeinde?
Richner: Grösste Herausforderung ist da das seit dreissig Jahren anhaltende Bevölkerungswachstum. Wenn es eine Ressource gibt, die nicht erneuerbar ist und nicht nachwächst, dann ist das der Boden. Damit ist Verdichten beim Bauen und Wohnen unumgänglich. Gemeinden müssen eine Verdichtungsstrategie formulieren. Das führt etwa dazu, dass der Wert des Landes beim einen steigt, beim anderen sinkt. Diskussionen darüber sind gewaltig.
Weltwoche: Verdichtung ist ja nicht gerade beliebt.
Richner: Ja, das meiste, was heute unter Verdichten läuft, kommt bei den Leuten schlecht an. Aber nehmen wir wieder das Beispiel Berner Altstadt. Das ist in der Schweiz wahrscheinlich die am dichtesten bebaute Fläche, und die meisten finden das fantastisch. Wie schaffen wir so etwas an neuen Orten? Warum gelingt das so selten? Da sind Architektur und Planung gefragt.
Weltwoche: Wie wird sich das Bauwerk Schweiz an Klimaveränderungen anpassen?
Richner: Es wird wärmer, und die dichtbebauten Gegenden sind meist nicht gut vorbereitet auf Erwärmung. Das Problem stellt sich vor allem in der Nacht und ist in Kombination mit einer älter werdenden Bevölkerung besonders heikel. Die Stadt Zürich beispielsweise versucht, sich vorzubereiten mit Begrünung oder dem Anlegen von Windkorridoren.
Weltwoche: Dann wird das Bevölkerungswachstum die Lage verschärfen?
Richner: Die Bevölkerung in der Schweiz ist jetzt dreissig Jahre lang etwa ein Prozent jährlich gewachsen. Was passieren wird, wenn bevölkerungsreiche Gebiete in Afrika und Asien einer stärkeren Erwärmung ausgesetzt sein werden, ist offen. Aber in den armen Ländern wird man nicht einfach auf Klimaanlagen umstellen können. Was vom Klimawandel her auf absehbare Zeit mit Abstand die grössten Auswirkungen haben wird, sind dadurch ausgelöste Bevölkerungswanderungen. Es ist nicht anzunehmen, dass dann alle Migranten nach Sibirien ziehen werden.
Weltwoche: Was ist eigentlich Ihr wichtigstes Anliegen mit Ihrer Forschung zum Bauwerk Schweiz?
Richner: Wenn die Schweiz das Ziel netto null 2050 gesetzt hat, ist zu bedenken, dass das, was heute gebaut wird, den Bestand von 2050 bilden wird. Man muss also im Bau heute schon umstellen: Die Technik zu Wärme, Kälte und Lüften, die typischerweise eine Lebensdauer von rund zwanzig Jahren hat, muss so angelegt werden, dass sie nachher wieder zurückgebaut werden kann. In diesen Materialien hat es graue Energie und graues CO2. Wir haben Initiativen ergriffen, zum Beispiel mit dem Architekten Werner Sobek von der Universität Stuttgart. «Design for disassembly», heisst sein Rezept: so bauen, dass alles später zerlegbar ist.
Weltwoche: Gibt es in der Branche denn Anreize zu einem so drastischen Umstellen?
Richner: Wir haben ein Projekt gestartet mit zwölf grossen Immobilieninvestoren, darunter Swiss Prime Site, Post, Bundesamt für Bauten und Logistik, UBS, AXA, dem Kanton Zürich, die eine Kreislauf-Charta unterschrieben mit der Verpflichtung, bis 2030 maximal noch 50 Prozent Primärmaterialien zu verwenden. Das betrifft Investitionen von jährlich rund drei Milliarden.
Weltwoche: Was ist dabei in erster Linie umzustellen?
Richner: Gebäude sind aus dieser Sicht eigentlich temporäre Materiallager. Das Material wird eine Zeitlang in einer bestimmten Immobilie gebraucht und findet anschliessend Verwendung in einem anderen Gebäude. Und das Management eines Lagers bedingt, dass man genau Inventar führt, sonst hat das Lager keinen Wert. Die erste Herausforderung ist also, einen genauen Überblick zu haben über das, was vorhanden ist. Und man muss auch eine Vorstellung davon haben, wie sich der Bedarf in den nächsten fünf Jahren entwickelt. Dies versuchen wir jetzt zu modellieren.
Weltwoche: Geht das in Richtung Occasionsmarkt?
Richner: Eine Frage kann lauten: Wie ist die bauliche Entwicklung des Glatttals in den nächsten zwanzig Jahren? Dabei fassen wir ähnliche Gebäude zusammen, etwa was das Energiesystem oder das Alter betrifft, und können so ein Gesamtbild berechnen. Damit kann man eine Vorhersage zum Rückbau machen. Wie viele und welche Fenster werden verfügbar für die nächste Generation Häuser? Oder welche Böden fallen zur Wiederverwendung an?
Weltwoche: Kann man alte Fenster denn noch brauchen?
Richner: Durchaus. Ob man ein neues, dreifachverglastes Fenster oder ein altes mit Doppelverglasung nimmt, ist eine relevante Frage, denn mit der Wiederverwendung spart man graue Energie und graues CO2. Man muss die Isolationsleistung gegen den Materialbedarf abwägen.
Weltwoche: Dann muss aber eine CO2-Einsparung finanziell honoriert werden.
Richner: Natürlich: Solange das Ausstossen von CO2 keinen richtigen Preis hat, solange die faire Abgeltung fehlt, ist eine Diskussion ohnehin sinnlos. Kostenwahrheit ist Voraussetzung für Nachhaltigkeit.
Weltwoche: Was wäre denn der faire Preis?
Richner: Heute beträgt die Abgabe auf Heizöl leicht 120 Franken pro Tonne CO2. Da muss man ansetzen und die anderen Emissionsquellen auch auf diese Weise mit einer Preisetikette versehen. Das wirkt.
Weltwoche: Dann wären alle anderen Massnahmen, Vorschriften, Verbote und Subventionen aber unnötig?
Richner: Ja. Ich habe vor einem Jahr zusammen mit Gianni Operto in der NZZ einen Vorschlag für eine CO2-Bepreisung gemacht. Zu meiner Überraschung hat Mitte-Präsident Gerhard Pfister diesen übernommen und als parlamentarische Initiative eingereicht. Die Nationalratskommission hat sie angenommen, sie kommt nun in die Ständeratskommission.
Weltwoche: Worum geht es dabei?
Richner: Es ist ein CO2-Gesetz mit vier Artikeln. Erstens: Jede CO2-Emission wird mit einer Abgabe belegt, unabhängig von der Quelle. Zweitens: Die Höhe der Abgabe bestimmt sich nach dem geplanten Emissionsabsenkpfad der Schweiz. Drittens. Die Abgabe muss zu 100 Prozent an die Bevölkerung zurückverteilt werden. Viertens. Beim Import von CO2-intensiven Produkten wird an der Grenze diese Abgabe fällig. Das ist das einzige etwas kompliziertere Element. Die EU geht auch in diese Richtung.
Weltwoche: Vier Artikel?
Richner: Ja, mehr braucht es nicht. Das letzte Mal stimmten wir über ein 43-seitiges CO2-Gesetz ab, welches die wenigsten gelesen haben. Das war komplexe Lobbyingarbeit, Feinmechanik zur Umverteilung, alle Interessengruppen suchten ihre Klientele zu bedienen. Für diese ist ein einfaches Vier-Artikel-Gesetz nicht attraktiv, weil man dann nicht Spezialgruppen bevorzugen kann. Man löst einfach ein Problem und fertig.
Weltwoche: Und das Preissystem regelt dann auch das Recycling am Bau? Wird Bauen teurer?
Richner: Es gibt mit nachhaltigem Bauen keine wirklichen Preissteigerungen, sondern einfach eine Verlagerung. Lebensdauerverlängernde Massnahmen sind ertragssteigernd. Energie und Material zu sparen, Sorge zu tragen zu den Dingen, das verbessert die Bilanz. Es braucht jedoch mehr Planung, weil noch keine Märkte für Wiederverwendung existieren.
Weltwoche: Was heisst mehr Planung?
Richner: Die Architektur muss gut sein. Ein nachhaltiges Gebäude ist immer von erstklassiger Qualität, sonst würde man keine Sorge dazu tragen. Schlechte Architektur wird wieder abgerissen. Ein Gebäude muss so konstruiert werden, dass es dereinst wieder auseinandergenommen werden kann. Diese Transformation wird sich über Jahrzehnte ziehen und ist auf langfristige Konstanz angewiesen, auf Persistenz, auch auf Stabilität der Rahmenbedingungen.
Weltwoche: Wenn es noch keine Märkte für Wiederverwendung gibt – ist das Preissystem dann zu lückenhaft?
Richner: Ja, es ist ein Problem, die ganz lange Frist in ökonomischen Modellen abzubilden. Ein Gebäude mit einer Lebensdauer von sechzig bis siebzig Jahren kommt anschliessend potenziell in eine Wiederverwendungsphase, aber diese kann man heute nicht vernünftig abbilden, weil dieser Horizont zu lang ist.
Weltwoche: Für Kalkulationen von Investoren?
Richner: Nehmen wir eine Decke, die vorfabriziert wurde und nach siebzig Jahren herausgenommen und an einem anderen Ort wieder eingesetzt werden kann. Die wird in den ersten siebzig Jahren auf null abgeschrieben, hat dann aber immer noch einen Wert bei der Weiterverwendung. Auf einen so langen Zeithorizont hinaus funktionieren unsere ökonomischen Modelle nicht. Damit funktionieren aber auch die ökonomischen Anreize auf lange Frist nicht richtig.
Weltwoche: Könnte denn Digitalisierung helfen, um das in den Griff zu bekommen?
Richner: Aktuell reden viele von Digitalisierung, von BIM, also «Building Information Modelling», auch andere Formen sind in Mode. Für unsere Ziele wäre die ganz einfache Form davon eigentlich die wichtigste: die Dokumentation. Steht man heute vor einem 45-jährigen Gebäude und fragt: Was ist da drin verbaut?, dann weiss man oft nicht viel darüber. Die Lehre daraus: Beim Bauen muss man sicherstellen, dass man einen digitalen Zwilling des Gebäudes anlegt, eine Kopie, in der man nicht nur alle Strukturen und Installationen abbildet, sondern auch die Materialien. Und das muss dann laufend nachgeführt werden, der digitale Spiegel muss immer stimmen.
Weltwoche: Apropos Materialien und Nachhaltigkeit – wie passt Ihrer Meinung nach der Beton dazu?
Richner: Ein super Baustoff, der jedoch einen extrem schlechten Ruf hat.
Weltwoche: Und was heisst das, alles in allem?
Richner: Das Material ist genial, wenn man es sich genau überlegt. Man nimmt dieses graue Pulver, Zement, gibt Sand, Steine und Wasser dazu, und daraus gibt es dieses unglaublich feste, tragfähige Material, das sehr dauerhaft ist. Man kann enorm viel damit machen, aber man muss gute Sachen damit machen. Der schlechte Ruf rührt von den CO2-Emissionen her, etwa 200 Kilo pro Kubikmeter Beton. Aber es gibt einen Lichtblick.
Weltwoche: Nämlich?
Richner: Pro Kilo sind die CO2-Emissionen von Beton viel geringer als von anderen Baumaterialien, nur in der Summe schlägt sie deshalb so schwer zu Buche, weil wir derart viel Beton brauchen. Und zweitens kann man in Beton mit neuen Verfahren CO2 binden, dadurch also den Treibhausgasgehalt in der Luft reduzieren.
Weltwoche: Beton als Reiniger?
Richner: Ein Beispiel ist die Verwendung von Pflanzenkohle. Pflanzen binden CO2 aus der Luft. Werden die Pflanzen pyrolisiert, also unter Sauerstoffabschluss erhitzt, ergibt das Pflanzenkohle, die dann als Zuschlagstoff in den Beton kommt. Diese Kohlenpellets ersetzen einen Teil von Sand und Kies im Beton, der auf diese Weise zu einem CO2-Aufnahmevehikel wird. Wenn es gelingt, mit dieser und weiteren Massnahmen die Materialien aus Beton CO2-negativ zu machen, dann haben wir beim Bauen einen grossen Hebel in der Hand zur Dekarbonisierung.
2 Kommentare zu “«Verdichten beim Bauenund Wohnen ist unumgänglich»”
Schreiben Sie einen Kommentar Antworten abbrechen
Sie müssen sich anmelden, um einen Kommentar abzugeben.
Noch kein Kommentar-Konto? Hier kostenlos registrieren.
Netiquette
Die Kommentare auf weltwoche.ch/weltwoche.de sollen den offenen Meinungsaustausch unter den Lesern ermöglichen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass in allen Kommentarspalten fair und sachlich debattiert wird.
Das Nutzen der Kommentarfunktion bedeutet ein Einverständnis mit unseren Richtlinien.
Scharfe, sachbezogene Kritik am Inhalt des Artikels, an Protagonisten des Zeitgeschehens oder an Beiträgen anderer Forumsteilnehmer ist erwünscht, solange sie höflich vorgetragen wird. Wählen Sie im Zweifelsfall den subtileren Ausdruck.
Unzulässig sind:
- Antisemitismus / Rassismus
- Aufrufe zur Gewalt / Billigung von Gewalt
- Begriffe unter der Gürtellinie/Fäkalsprache
- Beleidigung anderer Forumsteilnehmer / verächtliche Abänderungen von deren Namen
- Vergleiche demokratischer Politiker/Institutionen/Personen mit dem Nationalsozialismus
- Justiziable Unterstellungen/Unwahrheiten
- Kommentare oder ganze Abschnitte nur in Grossbuchstaben
- Kommentare, die nichts mit dem Thema des Artikels zu tun haben
- Kommentarserien (zwei oder mehrere Kommentare hintereinander um die Zeichenbeschränkung zu umgehen)
- Kommentare, die kommerzieller Natur sind
- Kommentare mit vielen Sonderzeichen oder solche, die in Rechtschreibung und Interpunktion mangelhaft sind
- Kommentare, die mehr als einen externen Link enthalten
- Kommentare, die einen Link zu dubiosen Seiten enthalten
- Kommentare, die nur einen Link enthalten ohne beschreibenden Kontext dazu
- Kommentare, die nicht auf Deutsch sind. Die Forumssprache ist Deutsch.
Als Medium, das der freien Meinungsäusserung verpflichtet ist, handhabt die Weltwoche Verlags AG die Veröffentlichung von Kommentaren liberal. Die Prüfer sind bemüht, die Beurteilung mit Augenmass und gesundem Menschenverstand vorzunehmen.
Die Online-Redaktion behält sich vor, Kommentare nach eigenem Gutdünken und ohne Angabe von Gründen nicht freizugeben. Wir bitten Sie zu beachten, dass Kommentarprüfung keine exakte Wissenschaft ist und es auch zu Fehlentscheidungen kommen kann. Es besteht jedoch grundsätzlich kein Recht darauf, dass ein Kommentar veröffentlich wird. Über einzelne nicht-veröffentlichte Kommentare kann keine Korrespondenz geführt werden. Weiter behält sich die Redaktion das Recht vor, Kürzungen vorzunehmen.








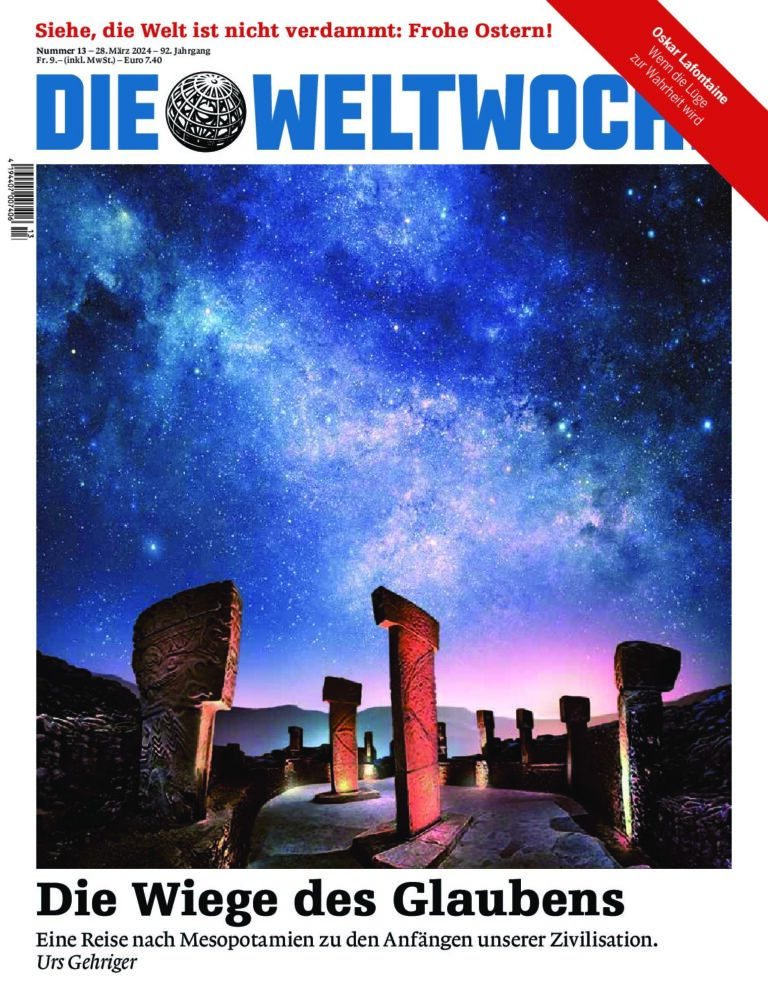
 Beat Gygi
Beat Gygi
Zurzeit sind tausende Ökonomie- und Landwirtschaftsgebäude in Dorfzonen unzähliger Landgemeinden durch das “Zweitwohnungsgesetz” vom Umbau zu Wohnzwecken blockiert. Viele dieser zum Dorfkern und Dorfbild gehörenden Ställe und Scheunen sind am zerfallen und würden durch Umbau exzellenten zusätzlichen Wohnraum bieten, wenn nicht dieses sinnlose Gesetz dies verhindern würde.
Die Grundannahme, dass das CO2 unser Klima mache, ist einfach falsch und unhaltbar. Deshalb ist Peter Richner mit den meisten Aussagen auf dem Holzweg. Dann bringt er natürlich noch das unsägliche Stromabkommen mit der EU aufs Tapet. Als ob das eine Lösung für die Probleme mit dem hanebüchenen Ausbau des Flatterstroms wäre. Viel Politik, viel Ideologie, viel Mainstream, aber wenig Brauchbares.